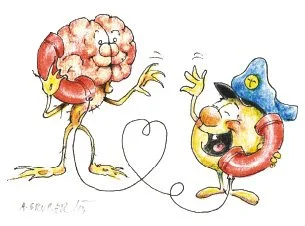Gut drauf – gut dran
Autor/in: Albert Gruber (Akad. Lehrer für Gesundheitsberufe, Krankenpfleger)
Ausgabe: Leben und Gesundheit, Juni/2013 - Optimismus
Wie eine positive Lebenseinstellung das Immunsystem stärkt.
Eine erlernbare Einstellung
Selbsthilfeliteratur, Broschüren von Versicherungen oder Krankenkassen oder auch einschlägige Internetseiten zeigen ganz klar: Optimisten leben länger, sind gesünder, erfolgreicher und glücklicher. Und das Besondere daran ist – Optimismus ist erlernbar!
Bei ausreichender Motivation und mit konsequentem Training, das Leben und die Welt durch eine rosa Brille zu sehen, kann man schon bald die positiven Auswirkungen des Optimismus am eigenen Leib verspüren. Aber wenn das scheinbar so einfach geht, warum sind dann viele Menschen trotzdem nicht in der Lage, ein gesundes, langes, erfolgreiches oder vor allem glückliches Leben zu führen? Trainieren ihnen der Optimismus zu wenig?
Gemäss wissenschaftlicher Forschungsliteratur, die sich mit dem Thema Optimismus und Gesundheit befasst, sind die Zusammenhänge zwischen Optimismus und einer gesunden Lebensführung sehr vielschichtig. Denn bei der einfachen Gleichung „Optimismus = Gesundheit“ – gilt es, vor allem den komplexen Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit eines Menschen mit seiner Bildung, seiner Lebenseinstellung, seinem sozialen Netzwerk, seinem Einkommen usw. und seiner Gesundheit zu beachten.
Sehr treffend bringt Sir Peter Ustinov die Persönlichkeit – Optimist und Pessimist – und ihre Lebenseinstellung auf den Punkt, wenn er meint:
„Optimisten sind die Menschen, die genau wissen, wie traurig und grausam das Leben sein kann. Pessimisten sind die, die es jeden Morgen wieder neu herausfinden.“
Es ist offensichtlich – als Optimist lebt es sich leichter. Die Psychologie definiert verschiedene Spielarten, die aber alle einen gemeinsamen Nenner haben: die Freude am Leben, die Lebenslust.
Erich Fromm hat es einmal so formuliert: „Es gibt nichts Anziehenderes, als einen Menschen, der lebt, und dem man ansieht, dass er nicht nur irgendetwas oder irgendwen, sondern das Leben liebt.“
Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt: Optimismus, Freude und Humor sind die genialen Mittel, um die Menschen zu „heilen“ (sollten), um den Ängsten, Schwächen, Enttäuschungen und den täglichen Sorgen mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. So wie es im folgenden Gedicht beschrieben ist:
Es ist, wie es ist,
tröstet sich der Realist,
wie schadet alles Mist,
bestätigt tröst der Pessimist,
welch ein Glück,
hebt ihn dem Mist,
freut sich der Optimist.
Er sieht das Gute im Garten,
alle Rosen darauf warten!
— Karl Heinz Karius
Wie aber wird nun die Gesundheit durch Optimismus gestärkt?
Die gesundheitliche Wirkung von Optimismus, Humor und Lebensfreude lässt sich laut Forschungsergebnissen in Wesentlichen in folgenden Bereichen erkennen:
Höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress durch eine verminderte Ausschüttung von Stresshormonen und einem nur schwachen Anstieg des Blutdrucks.
Eine bessere Funktionstüchtigkeit des Immunsystems.
Pessimistische Personen verfügen im Vergleich zu optimistischen Personen beispielsweise über weniger T-Helferzellen und Immunglobuline, Zellen also, die für die Immunabwehr des Körpers verantwortlich sind.
Optimismus motiviert den Menschen zu einer gesunden Lebensweise. Pessimisten gehen oft nicht sorgsam mit sich um.Optimismus wirkt sich auf die Anzahl der regenerativen Enzyme im Leben aus.
Pessimisten erleben häufiger „Katastrophen“. Wahrscheinlich erleben Optimisten dieselbe Anzahl von Erfolgen und Niederlagen wie Pessimisten, aber sie gehen anders damit um. Ein Optimist spricht nicht von Problemen oder Ängsten, von Schwierigkeiten und Hindernissen, sondern er spricht von seinen Hoffnungen, Träumen und Wünschen, von seinen Zielen und von seinem Weg dorthin.Optimisten erhalten mehr „soziale Unterstützung“, weil sie mehr Sozialkontakte als Pessimisten haben und diese auch besser pflegen.
So weit die Aussagen der Wissenschaft.
Gefühle sind von grosser Bedeutung
Wir wissen heute ganz genau, dass z. B. für das gute Funktionieren des Immunsystems eine gesunde Lebensweise wichtig ist und dass einer optimistischen, heiteren Lebenseinstellung dabei eine entscheidende Rolle zukommt. Natürlich wird unsere Gesundheit überwiegend von den Genen und der Umwelt bestimmt, aber auch von dem, was wir denken, fühlen und tun.
Es ist heute unbestritten, dass trotz der grandiosen Geistesleistungen vorwiegend Gefühle und Emotionen unser Leben bestimmen. Allerdings würgen viele Menschen ihre Gefühle zu sehr ab – die guten wie die negativen.
Ein auf diese Weise «deprimiertes» Immunsystem ist für Mikroorganismen (Bakterien, Viren) wahrscheinlich so attraktiv, wie ein Marmeladenglas für Wespen oder Bienen.
Was dagegen eine positive Einstellung z. B. nach einer Operation bewirken kann, zeigt folgendes Forschungsergebnis:
Motiviert durch die Psychologin Maidolon Peters (Universität Maastricht) haben Ärzte in den vergangenen Jahren eine Reihe erstaunlicher Zusammenhänge aufgedeckt. So erholen sich Optimisten schneller von Operationen als Pessimisten, sie spüren weniger Schmerzen, haben eine bessere Wundheilung, einen niedrigeren Blutdruck und eine bessere Immunabwehr. Sie sehen also: Optimismus lohnt sich!
Es gibt nichts Anziehenderes, als einen Menschen, der liebt, und dem man ansieht, dass er nicht nur irgendetwas oder irgendwen, sondern das Leben liebt.
Eine kleine Reise in das Netzwerk der Psychoneuroimmunbiologie
In den Blutgefässen befinden sich rote (Erythrozyten) und weisse (Leukozyten) Blutkörperchen. Die roten transportieren den für die Zellatmung und den Zellstoffwechsel so lebenswichtigen Sauerstoff und auch Stickstoffverbindungen und das CO₂ (dieses muss wieder ausgeatmet werden). Die weissen sind die Soldaten des körpereigenen Abwehrsystems, dem sogenannten Immunsystem.
Von den weissen Blutkörperchen gibt es verschiedene Arten: T-Zellen und B-Zellen (Lymphozyten), Fresszellen (Makrophagen), segmentkernige Zellen (Granulozyten) u. v. a.
Die T-Zellen sind das Zentrum des Immunsystems. Sie sind die Kommandozentrale und geben spezifische Signale an die B-Zellen, an die Fresszellen usw.
Auf Befehl der T-Zellen produzieren die B-Zellen Antikörper (Y-förmige Proteine), die sich dann an die Bakterien festsetzen und somit die Krankheitserreger als „körperfremd“ stigmatisieren.
Solche gekennzeichneten Feinde werden von den Fresszellen erkannt und vernichtet. T-Zellen geben aber nicht nur Kommandos, sie greifen auch aktiv in Form von Killerzellen in die Abwehrschlacht ein. Sie setzen chemische Waffen ein und durchbohren (perforieren) die gekennzeichneten Krebszellen und Krankheitserreger. Diese braunen Soldaten sind unsere Sekunde für Sekunde bemüht, unsere Gesundheit zu erhalten.
Aber wie bemerkt eine T-Zelle, ob der Mensch, in dessen Körper sie lebt, gestresst oder traurig ist? Wie erreicht der natürliche Killerzelle psychische Belastungen? Wie erfährt die T-Zelle, wie heftig gerade Bakterien z. B. den Darm traktieren?
Ein perfekt organisiertes Kommunikationsnetz
Nervensystem, Hormonsystem und Lymphsystem sind die Hauptakteure.
Die Nervenfasern des vegetativen Nervensystems sind mit dem Gewebe des Immunsystems direkt verbunden. Sie senden Reize an den Thymus, die Milz, die Lymphknoten, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe des Darms.
Die vielen weitverzweigten Enden dieser Nervenfasern liegen direkt neben der Immunzelle, die sich in diesem Gewebe aufhält. Während klassische Synapsen (Kontaktstellen) in zentralen Nervensystem etwa 20 Millionen Millimeter von der nächsten Nervenfaser entfernt sind, trägt der Abstand zwischen der Synapse einer peripheren Nervenfaser und einer Lymphozyt oder einer Fresszelle nur 6 Millionstel Millimeter!
Dieser sprechender Aktiverüberträger sorgt für den Austausch. Das heisst:
Nerven, Immunzellen und Hormone können sich Nachrichten zusenden, Reize empfangen und verstehen.
Die «reden» miteinander!
Einen zweiten Kommunikationsweg bilden die Neuropeptide und Hormone, die über die Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) die überseuflauer Region gelangen und somit direkt mit Immunzellen in Kontakt kommen. Auch auf diesem Weg wird die «Kampfeslust» des Immunsystems oftmals bei gehäuftem chronischem Di-Stress (belastender Stress) wirksam geschwächt.
Der sechste Sinn
Dr. Hans Selye, der Begründer der Stressforschung, hat die Zusammenhänge schon vor vielen Jahrzehnten beschrieben.
Ausdauern ist die Wissenschaft davon überzeugt, dass das Immunsystem eine Art sechster Sinn des Nervensystems ist.
Es registriert das, was wir nicht fühlen, sehen, hören, riechen, schmecken und mit dem Gleichgewichtssinn erfassen können, nämlich Bakterien, Viren, Pilze, Würmer und Krebszellen, und reagiert darauf mit der Produktion von Botenstoffen, die das Gehirn versteht.
Und hier schliesst sich der Kreis: Nicht nur das Nervensystem sendet Signale an das Immunsystem, auch das Immunsystem sendet Signale an das Gehirn. Dieser Kommunikationsnetz ist keine Einbahnstrasse. Das Hirn versteht die Sprache des Immunsystems und das Immunsystem versteht die Sprache des Gehirns!
Und die beiden sind sich sehr ähnlich: Sie leben und leiden gemeinsam. Sie sind, wie schon erwähnt, miteinander verbunden (nur 6 Millionstel Millimeter voneinander entfernt). Wenn z. B. die T-Zellen das Gehirn fragen, wie es ihnen so geht, und das Gehirn antwortet: «es geht gut», dann stärkt das die T-Zellen.
Das Gehirn sendet dabei gute, elektrische Signale und Endorphine (Glückshormone) an die T-Zellen, die dadurch aktiviert und gestärkt dem Kampf um unsere Gesundheit aufnehmen. Wenn aber das Gehirn über Sorgen, Ängste, Furcht, Misstrauen, chronischen Pessimismus, über permanente Reizüberflutung klagt, wird die Kampflust der T-Zellen massiv geschwächt, und die Gesundheit bleibt auf der Strecke.
Wie lob ich mir da einen gesunden heiteren Optimismus!
Ein Optimismus, mit dem ich freudig durchs Leben gehen kann, der aus einer dankbaren Haltung unserem Schöpfer gegenüber entspringt und der im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe seine festen Wurzeln hat.
„Ein Optimist steigt auf der Leiter trotz schlechter Sprossen immer weiter und stärkt damit bei alledem mit Frohsinn sein Immunsystem. Das Herz, der Kreislauf, Leber, Nieren dürfen diese Stärkung spüren. Ja, pures Wohlbefinden im Verbund, kurz – Optimismus hält gesund!“