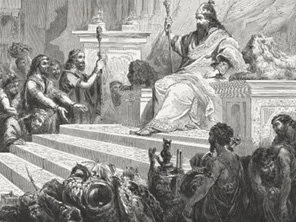Optimismus mit Geschichte
Autor/in: Matthias Müller (Religionspädagoge (M.A.), TV-Redakteur, Fotojournalist und Autor)
Ausgabe: Leben & Gesundheit, April/2019 - Optimismus
Viel Zeit hatte ich nicht. Bin ich aber nun schon in Wien, wollte ich auch das Victor-Frankl-Museum besuchen. Wer war der Mann, der den Holocaust überlebt und etwas mitgebracht hatte, was vielen Menschen später eine Lebenshilfe war?
Bewegende Einblicke
Wiener Nebenstraße. Schwere Holztür. Rot-weiße Fähnchen – hier muss es sein. Ein paar Treppen, ein enger Flur mit freundlicher Kassiererin – und schon lief mir die Zeit davon: Es gab in Frankls ehemaliger Wohnung so viel Interessantes zu lesen und zu sehen!
Der Psychiater hielt 1921 einen ersten Vortrag «Über den Sinn des Lebens» und organisierte 1931 mit seinen Jugendberatungsstellen eine Sonderaktion. Dadurch gab es in Wien während der Zeit der Zeugnisausgabe erstmals seit Jahren keinen Schüler-Selbstmord.
Wegen seiner jüdischen Herkunft durfte er nach dem «Anschluss» Österreichs an das «Deutsche Reich» keine «arischen» Menschen mehr behandeln (Übrigens, einer der großen Fehler aller Diktaturen: Sie berauben sich ihrer besten Köpfe selbst!). Um bei seinen Eltern zu bleiben, ließ er 1939 sein Ausreisevisum in die USA verfallen. Drei Jahre später wurde fast die gesamte Familie in ein Konzentrationslager verschleppt. Nur er überlebte und verfasste bald nach Kriegsende das Buch «… trotzdem Ja zum Leben sagen».
Wer nach so viel schrecklichem Leid dennoch «Ja» zum Leben sagt, kennt Gründe. Frankl beobachtete während seiner Gefangenschaft, dass Menschen, die sich nicht aufgaben, eine größere Überlebenschance hatten als andere, die mit einer pessimistischen Grundhaltung litten.
Bis heute gibt es keine einhellige Meinung darüber, wie der Mensch zu einer optimistischen Haltung kommt. Ist es Vererbung, Erziehung, Training? Vielleicht ein wenig von allem? Wissenschaftler sagen, dass Optimismus erlernbar sei.
Verspottetes Genie
Der Begriff «Optimist» geht wohl auf eine spöttische Bezeichnung von Jesuitenpatern für den Mathematiker und Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) zurück. Sie machten sich über den letzten europäischen Universalgelehrten lustig, weil er als Nichttheologe das Spannungsfeld zwischen «gutem Gott» und «schlechter Welt» in seinem Werk «Theodizee» aufzulösen suchte.
Leibniz hat die Differential- und Integralrechnung entdeckt und durch die Entwicklung des dualen Zahlensystems die Grundlage für die Digitalisierung gelegt. Er war der Meinung, dass Gott «die beste aller möglichen Welten» geschaffen habe – also dass das Gute immer über das Böse siegen werde.
Entscheidende Grundhaltung
Eine Frau kaufte im Stoffladen ein. Ihr Mann kam von einigen Besorgungen zurück. Als er die Menge Stoff sah, die sie schon hatte abschneiden lassen, fragte er: «Willst du das alles kaufen?» «Ja,» antwortete sie und wies dabei auf die vielen Stoffballen im Regal, «aber schau doch, was ich alles nicht nehme!» – Es kommt wirklich auf die Sichtweise an.
Die Beobachtungen Frankls bestätigen sich vielfach. Im Allgemeinen leben Menschen lieber mit Optimisten zusammen als mit Pessimisten, vorausgesetzt, die Optimisten haben die Bodenhaftung nicht verloren. Bei Pessimisten werfen kleine Dinge große Schatten.
Widersprüche
Ich habe bei manchen Menschen eine merkwürdige Widersprüchlichkeit gefunden. Sie sagen, dass alles schlimmer werde und es auf der Welt nur noch bergab gehe. Und doch haben sie Kinder, freuen sich über ihre Enkel und tun alles, damit diese es im Leben gut haben und weit bringen. Fragt man die Welt-Pessimisten, zu welcher Zeit sie denn lieber gelebt hätten, entret man in der Regel Schweigen. Wenn nur noch schlechter werde, muss ja früher alles besser gewesen sein.
Ja, es gibt in unserer Zeit gravierende Probleme, aber auch verändernde, enorme Fortschritte. Das pauschale Urteil, alles werde nur noch schlechter, trifft nicht zu. Nach dem Report der Bill und Melinda Gates-Stiftung ist der Anteil der Menschen unterhalb der absoluten Armutsgrenze in den letzten 30 Jahren von 36 % auf 9 % gefallen. So erschreckend die Armut ist, sollte man doch die positive Entwicklung würdigen. Die Müttersterblichkeit ging im gleichen Zeitraum auf rund die Hälfte zurück, der Zugang der Menschen zu Sanitäranlagen in Problemländern wurde in den letzten 30 Jahren deutlich besser mit all den positiven Folgen einer hygienischen Lebensweise. Vom Waldsterben durch sauren Regen hört man nichts mehr. Die Menschen in Japan brauchen keine Sauerstoff-Atem-Tankstellen mehr wie noch vor Jahrzehnten. In europäischen Flüssen, die vor Jahren noch Kloaken waren, schwimmen wieder Menschen und Fische. Ist damit alles gut? Bei weitem nicht! Schon ausgerottet geglaubte Krankheiten kehren zurück, und man befürchtet, dass in einigen Jahrzehnten die Schweiz gletscherfrei sein könnte – mit all den Folgen, die wir heute in den Wetterkapriolen schon angedeutet bekommen. Das Artensterben macht ebenso Sorgen wie die Vermüllung der Meere. Der in Winterthur (Schweiz) ansässige Club of Rome hatte 1972 mit der Veröffentlichung von «Die Grenzen des Wachstums» einen Weckruf erlingen lassen. Zwar haben sich nicht alle Annahmen von damals, z. B. über den Rohstoffverbrauch, bestätigt, aber die Grunderkenntnis, dass wir Menschen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung unserer Welt haben, wurde deutlich. Wie soll man mit den Herausforderungen umgehen? Die Hände pessimistisch in den Schoß legen, die Entwicklungen als unausweichliche Zeichen des Weltendes deuten oder zukunftsorientiert, d.h. optimistisch handeln?
Pessimist oder Optimist?
Vor rund 3000 Jahren lebte der berühmte König Salomo, dem man leicht Pessimismus nachsagen könnte. Er ging als weiser Mann in die Geschichte ein. Wenn man liest, was von ihm schriftlich erhalten ist, klingt einiges sehr melancholisch, um nicht zu sagen: traurig. Ein Auszug seiner Dichtungen ist sogar von der ehemaligen DDR-Kult-Rockgruppe «Die Puhdys» für einen Film-Song verwendet worden, wobei hinter dem «Eisernen Vorhang» nie offengelegt wurde, dass der Text der Bibel entlehnt war. Dort denkt Salomo über verschiedene Phasen seines Lebens nach: Alles hat seine Zeit – bauen, abreißen, pflanzen, ausreißen usw. Im Blick auf die hohen Abschnitte seines Daseins sagt er zusammenfassend: Das Leben ist wie ein ständiges Haschen nach Wind, nichts bleibt. Letztlich hängt er die Frage an den Raum: Wofür lohnt es sich zu leben? Oder anders: Hat es Sinn, sich für den Erhalt dieser Welt einzusetzen? Seine Antwort scheint wenig ermutigend: «Die Toten haben es besser als die Lebenden.» Das ist nicht nur pessimistisch, sondern geradezu depressiv. Dabei wird ihm klar, dass er eine hohe Mitverantwortung daran hat, was aus seinem Leben wurde. Er schlug in vielerlei Hinsicht über die Stränge und hielt sich nicht an das, was ihm am Anfang seines Weges mitgegeben worden war. Nun beklagt er die Folgen, um dann aber zu einer positiveren Sicht zurückzukehren. Er ruft auf, die fröhlichen Möglichkeiten des Lebens dankbar zu genießen und die Aufgaben, die vor einem liegen, tatkräftig anzugehen. Das ist nun mal, wenn man optimistisch davon ausgeht, dass das eigene Handeln positive, sinnvolle Wirkung haben wird. Oder wie es Viktor Frankl treffend formulierte: «Das wahre Ziel des Menschseins weist immer über das Ich hinaus auf etwas anderes oder jemand anderen. Menschen sind darauf angelegt, für einen größeren Sinn als sich selbst zu leben.»
Wie soll man mit den Herausforderungen umgehen? Die Hände pessimistisch in den Schoß legen, die Entwicklungen als unausweichliche Zeichen des Weltendes deuten oder zukunftsorientiert, d.h. optimistisch handeln?
Alltägliches soll nicht «Ewiges» verdrängen
Wir sind oft so mit Alltäglichem und Materiellem beschäftigt, ob es den nackten Überlebenskampf betrifft oder das Träumen vom Wohlstand, dass wir das aus den Augen verlieren, was wirklich zählt.
Bei vielen Menschen sind gut und üppig essen, Unterhaltung und Freizeit sowie sich gut und modebewusst kleiden zum Lebensinhalt geworden. Genuss und Status – das kann uns Menschen ganz schön in den Bann ziehen. Sie haben die Macht, die Leere in unseren Herzen und in unserem Leben zu überspielen und für kurze Zeit zu stillen. Aber Genuss, Wohlstand und Status machen nicht dauerhaft «satt». Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, der Leib ist mehr als Kleidung. Wahre Schönheit und wahre Unbekümmertheit sind Geschenke Gottes. Das rufen uns die Spatzen und die Lilien zu. Wahre Schönheit kommt von innen!
Wahrscheinlich ist es das, was Abraham Lincoln sagen wollte: «Ich mag sein Gesicht nicht», meinte er, nachdem er sich mit einem Mann unterhalten hatte. «Der arme Mann», erwiderte ihm ein anderer. «Ein Mensch kann doch nichts für sein Gesicht.» – «Jeder ist für sein Gesicht verantwortlich, sobald er die Vierzig überschritten hat», entgegnete der amerikanische Präsident.
Unsere Ausstrahlung, unsere Zufriedenheit, unser innerer Friede sind Ausdruck unserer Werte und unserer Lebensziele. Lassen Sie nicht zu, dass die Sorgen um das Alltägliche diese wichtigen Themen und Fragestellungen ersticken!
Was hat Ewigkeitsswert? Was bleibt, wenn wir die Bühne dieser Welt einmal verlassen müssen? «Das letzte Hemd hat keine Taschen» – heißt es im Volksmund. Nichts von dem, was wir uns hier hart erarbeitet haben, können wir aus dieser Welt mitnehmen.
Bei uns im Flur hängt ein Poster. Darauf ist ein kleiner Junge zu sehen, der auf einer Düne steht und mit dem Rücken zum Betrachter auf das Meer hinausschaut. Darunter stehen die Worte: «In 100 Jahren wird niemand danach fragen, was für ein Haus ich bewohnt oder Auto ich gefahren habe oder wie hoch der Saldo meiner Bankkonten war. Aber die Welt wird in 100 Jahren dadurch ein besserer Ort sein, dass ich im Leben eines Kindes wichtig war.»
Die Beziehung zu unserem Partner, zu unseren Kindern, zu unserer Herkunftsfamilie, zu unseren Mitmenschen. Und für all jene, die an einen persönlichen Gott glauben, auch die Beziehung zu ihm.
Die Frage bleibt: Wie werden wir nun unnötige Sorgen los?
Unser Leben in der Gegenwart gestalten
Man kann in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben, und das machen viele Menschen. Auch Ihnen und mir kann dies widerfahren. Man kann in der Vergangenheit schwelgen, sich an vergangene Dinge, die man verloren hat, klammern oder sich verbittert an erlittenem Unrecht festkrallen.
Man kann auch in der Zukunft leben und von Dingen träumen, die man sich wünscht, oder sich von Sorgen aufzehren und lähmen lassen. Wirklich unser Leben gestalten können wir nur in der Gegenwart. Es sind die Entscheidungen und Taten, die unser Leben verändern. Eines der mächtigsten Werkzeuge im Umgang mit Sorgen – und das klingt jetzt vielleicht etwas banal – ist das Handeln. Wer immer nur grübelt und nichts tut, lässt die Sorge immer umfangreicher und unheimlicher werden. Die gefühlte Ohnmacht wird immer größer. Wer jedoch handelt, wenn auch nur in kleinen Schritten, gewinnt immer mehr die Kontrolle über das eigene Leben.
Wichtiges an die erste Stelle setzen
Werden Sie sich bewusst, was die wichtigsten Dinge deines Lebens sind und wer die wichtigsten Menschen in Ihrem Leben sind! Planen Sie dafür in Ihrem Alltag feste Zeiten ein! Lassen Sie sich dabei vom Bild der mit Steinen, Kieselsteinen, Sand und Wasser zu füllenden Gläser leiten. Die größten Steine symbolisieren das, was absoluten Vorrang in unserem Leben hat. Wer zuerst das Wichtigste in den Alltag hineinpackt, hat noch Zeit und Kraft für Zweit- und Drittrangiges. Wer sich zuerst mit Nebensächlichem abgibt, wird keinen Platz mehr für das Wesentliche finden.
Stellen Sie sich das Schlimmste vor, das in einer bestimmten Lebenslage passieren kann
Manchmal hilft es, wenn wir unsere Sorgen bis ins Extreme und Skurrile «aufblasen». Oft fallen sie dabei in sich zusammen und ringen uns ein Lächeln ab. Was ist das Schlimmste, das geschehen kann, wenn ich heute – verkehrsbedingt – 10 Minuten zu spät zur Sitzung komme? Die fristlose Kündigung? Nein, sicherlich nicht! Wenn wir uns das Schlimmste vorstellen und diesen Gedanken zulassen, gehen wir entspannter in schwierige Situationen hinein.
Gewinnen Sie Abstand zu Ihren Sorgen im Gespräch mit einer Vertrauensperson
Manchmal kreisen unsere Sorgen in und über unserem Kopf wie Geier. Dieselben Gedanken und Befürchtungen zwingen sich uns immer wieder auf. Da hilft das Gespräch mit einem guten Freund, dem Ehepartner oder einer Fachperson. Sorgen auszusprechen, auf den Tisch zu legen und sie mit innerem Abstand zu betrachten, kann uns helfen, die Gedanken neu zu ordnen und Prioritäten zu setzen. Wir können unmöglich alle Baustellen in unserem Leben gleichzeitig bearbeiten.
Zum Schluss noch ein Gedanke: Vergessen Sie das Feiern nicht! Der Mensch wurde nicht dazu geschaffen, ein Leben lang nur Sorgen vor sich herzuschieben. Er soll auch auf Gelungenes und Schönes zurückschauen und feiern können.
„Das wahre Ziel des Menschseins weist immer über das Ich hinaus auf etwas anderes oder jemand anderen. Menschen sind darauf angelegt, für einen größeren Sinn als sich selbst zu leben.“